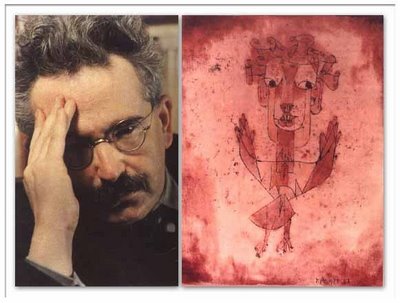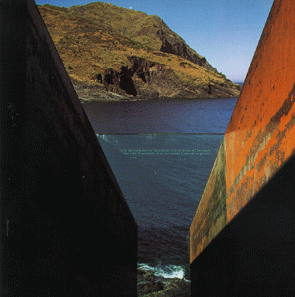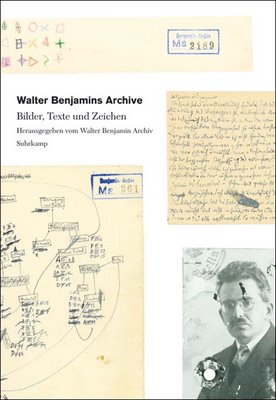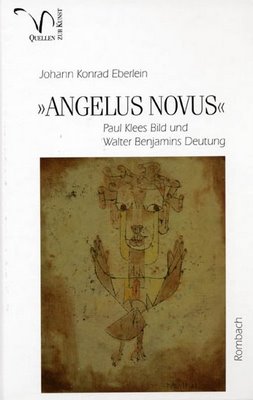|
|
Andreas Höflich
Walter Benjamins Text
»Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit«
und seine Bedeutung für die ästhetische Theorie
Inhalt1. Einleitung
2. Das Kunstwerk und der Verlust seiner Aura
3. Adorno und der Begriff der Aura
4. Bezüge zu Jean-François Lyotard
5. Schlußbemerkungen
6. Bibliographie, Fußnoten
1. Einleitung
Schon früh haben Philosophen und Musiker versucht, auf der einen Seite Standards und einen Kanon dessen festzulegen, was als musikalisch »schön« anzusehen ist, auf der anderen gaben Musiker ihrer Musik eine wissenschaftliche Fundierung, teils als Erklärung teils als Rechtfertigung. In dieser Arbeit soll versucht werden den bedeutenden Text »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« (1) von Walter Benjamin in Zusammenhang zu bringen mit ästhetischen Texten, welche die Musik betreffen. Benjamins Arbeit, die mehr den Verlust der Aura in Hinblick auf visuelle Künste, wie etwa Photographie, Film oder Malerei und Bildende Kunst beklagt, ist aber dennoch für die Rezeption von Musik in der sogenannten Postmoderne von Bedeutung. Als wichtig in diesem Zusammenhang erschienen dem Autor die Interdependenzen mit zeitlich später erschienen Texten zu sein. Ähnlich in ihrer Herangehensweise kristallisierten sich Abhandlungen der sogenannten Poststrukturalisten oder Postmodernisten heraus, die explizit und im Detail auf die Musik als künstlerische Ausdrucksform eingehen. Die Frage, der nachzugehen ist, ist in wieweit sich die Rezeption von Musik mit der Möglichkeit ihrer technischen – und damit - unendlichen Reproduktion verändert, und wenn dem so ist, ob diese neue Rezeption sich auch auf das zu betrachtende Werk an sich auswirkt. Die Situation, in der der moderne Mensch Musik rezipiert, hat sich mit den Medien der Tonaufzeichnung verändert. Die Situation, in die sich der Musikhörer im neunzehnten Jahrhundert begeben mußte, unterscheidet sich fundamental von der des Musikliebhabers im zwanzigsten Jahrhundert.
Mußte sich der Rezipient im vergangenen Jahrhundert in den Konzertsaal bemühen, oder die Musik erklang bei einem Hausmusikabend, so kann der moderne Mensch Musik hören wann immer er will und in jeder Situation, die wahrscheinlich immens von der abweicht, die der Komponist sich für das Ertönen seiner Musik erdacht oder gewünscht hat. Nach Veröffentlichung seines Werkes z.B. auf einer CD, hat er keine weitere Verfügungsmacht über seine Komposition. Der rituelle Charakter der Musik, das Religionsähnliche der Musik, das Wagner mit seinem Festspielhaus bis zur Perfektion trieb, ist dem in der Neuzeit lebenden Menschen abhanden gekommen. Die Frage ist nun, wie sich diese Situation auf das Kunstwerk selbst auswirkt und ob es von Seiten der Philosophen Bestrebungen gab, wenn schon nicht diese Entwicklung zu bekämpfen - was ein aussichtsloses Unterfangen wäre – so doch Erklärungsversuche zu unternehmen, um diesen fundamentalen Wechsel im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Kunst in ihre Überlegungen mit einzubringen.
2. Das Kunstwerk und der Verlust seiner Aura
Der Text von Walter Benjamin aus dem Jahre 1935 beschreibt die einschneidenden Veränderungen der Arbeitswelt durch Automatisierung und Kapitalisierung, die sich mit zeitlicher Verzögerung auf den Bereich der Kunst auswirken. Dieser Wandel – in seiner ökonomischen Begründung und im gesellschaftspolitischen Zusammenhang - ist Gegenstand Benjamins Analyse. Die auf diese Weise von Benjamin extrahierten »Entwicklungstendenzen der Kunst unter den gegenwärtigen Produktionsbedingungen« (2) werden von einem Phänomen dominiert: dem »Verfall der Aura« (3).
Als Bündelung diverser Veränderungen, die dem Kunstwerk im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit widerfahren, wird dieser Ausdruck notwendigerweise mehrdeutig. »Das Hier und Jetzt des Kunstwerks« (4) als historische Trägersubstanz, die seine Autorität und Echtheit ausmacht, geht durch die Reproduktion verloren.
Benjamin schickt voran, daß Kunstwerke schon immer reproduziert wurden, jedoch als Übung von Schülern, und von Meistern zur Verbreitung der Werke. Auch Musik wurde immer schon reproduziert, da als Überlieferung ja nur der Notentext vorhanden war. Der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich aber der technischen Reproduktion. Laut Benjamin erhält die manuelle Reproduktion gegenüber dem »Original« seine Autorität aufrecht. Bei der technischen ist dies nicht der Fall, da sie dem Original gegenüber selbstständiger ist, als die manuelle. Dies beruht auf zwei Dingen:
— Die technische Reproduktion kann beispielsweise in der Photographie Ansichten des Originals hervorheben, die nur der technischen Linse aber nicht dem bloßen Auge sichtbar sind.
— Sie kommt dem Aufnehmenden, dem Rezipienten entgegen. Die Schallplatte holt Musik in die Wohnung des Hörers, die eigentlich in einem Konzertsaal oder einer Kathedrale ausgeführt wurde.
»Die Umstände, in die das Produkt der technischen Reproduktion gebracht werden kann, mögen im übrigen den Bestand des Kunstwerks unangetastet lassen - sie entwerten auf jeden Fall das Hier und Jetzt.« (5) Eine Aufnahme einer kunstvollen Komposition, dazu noch kunstvoll ausgeführt, bleibt immer noch ein "Dokument" eines Augenblicks, das das Kunstwerk in seinem Bestand nicht antastet. Es ist jedoch nur noch ein Dokument und nicht mehr das Kunstwerk selbst.
Was weiterhin verloren geht, ist die »Echtheit« (6) eines Kunstwerks, die Inbegriff seiner materiellen Dauer als auch ihrer geschichtliche Zeugenschaft ist. Somit gerät durch die technische Reproduktion die "Autorität der Sache" (7) ins Wanken. Die Echtheit wiederum hat ihre Fundierung im Ritual, in dem das Kunstwerk seinen originären Gebrauchswert hatte. Benjamin faßt nun alle diese Verlusterscheinungen in dem Begriff des Verlusts der Aura zusammen. »Die Reproduktionstechnik, so ließe sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens sein massenweises.« (8)
Ein anderer Aspekt der Aura, nämlich ihre Wahrnehmung, wird weiterhin beschrieben. So gewinnt im Kontext der These, die sich mit dem historischen Wandel der Sinneswahrnehmung beschäftigt in obiger Definition das Wort »Erscheinung« besondere Bedeutung. Es handelt sich um den subjektiven Eindruck von Einmaligkeit und Ferne. Der Verfall der »Aura« muß also mit dem Bruch wenigstens eines dieser beiden Grundpfeiler ihrer Rezeption zusammenhängen. Benjamin sieht sie beide untergraben: »Die Dinge sich räumlich und menschlich ›näherzubringen‹ ist ein genau so leidenschaftliches Anliegen der gegenwärtigen Massen wie es ihre Tendenz einer Überwindung des Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion ist.« (9)
Da die Aura nicht von der Ritualfunktion eines Kunstwerks zu trennen ist, löst sich das Kunstwerk durch seine technische Reproduktion erstmals von seinem parasitären Dasein an das Ritual, und die Authentizität ersetzt den Kultwert. Ein reproduziertes Kunstwerk wird somit die »Reproduktion eines auf Reproduzierbarkeit angelegten Kunstwerks« (10). Aus den für die Rezeption eines Kunstwerks wichtigen Funktionen hebt Benjamin zwei heraus:
— Den Kultwert.
— Den Austellungswert des Kunstwerks.
Ein sakrales Kunstwerk hatte zuerst einmal die Funktion, daß es zu Ehren Gottes gemacht wurde, erst an zweiter Stelle kam es auf sein Betrachten an, wenn überhaupt. Mit der technischen Reproduktion ist nun die Austellbarkeit eines Kunstwerkes in gewaltigem Maße gestiegen. Früher lag das Gewicht auf dem Kultwert eines Kunstwerks, erst dann auf seinem Kunstwert. Was jetzt zählt ist zuerst der Austellungswert eines Kunstwerks, dessen Kunstwert man erst später/beiläufig erkennt. Das nach Magie und Religion das Kunstwerk auch immer schon einem »profanen Schönheitsdienst« (11) verpflichtet war, tut dieser Definition keinen Abbruch, da er auch eine Form des Kults ist, immer noch auf die Einmaligkeit des Kunstwerks angewiesen, da diese ihren Maßstab, die Echtheit begründet. Die Aura wird hier also als Übermittlerin von traditionellem Kunstwert beschrieben. Dieser wird mit ihrer Vernichtung durch die Reproduktion zerstört - der Kultwert verliert an Bedeutung, während der Ausstellungswert immer dominanter wird, bis er »[in] der Photographie [...] den Kultwert auf der ganzen Linie zurückzudrängen« (12) beginnt. Die Thesen zur Massenwirkung z.B. des Films werden hier nicht in die Überlegungen eingebracht, da der Fokus diese Arbeit auf die Auswirkungen auf die Musik und musikphilosophischen Betrachtungen gerichtet sein soll.
3. Adorno und der Begriff der Aura
Ohne den Begriff zu verwenden, hat sich Adorno zu dem Problem, das in Benjamins ikonoklastischer These angesprochen ist, schon 1938 in seinem Aufsatz »Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens« (13) geäußert. In der Auseinandersetzung mit der neuen Unterhaltungskultur kommt er hier zu einem Befund, der in Benjamins Sprache ein Verlust der Aura in der Musik genannt werden müßte. Adorno stellt aber weit mehr als Benjamin die Bedeutung der Musik als »Waren-Fetisch« dar. Während Benjamin versucht, sich mittels der Begriffe »Kultwert« und »Ausstellungswert« um terminologische Äquivalente für die politökonomischen Begriffe des Gebrauchs- und Tauschwertes zu bemühen, analysiert Adorno in seinem frühen Aufsatz die Musik ganz unverstellt als Ware. Die Änderung der Rezeptionshaltung gegenüber dem Kunstwerk, die Benjamin als »Zerstreuung« bezeichnet, nennt Adorno »Dekonzentration« und deutet so schon seinen Pessimismus an. Was jenem Anlaß zu politischem Optimismus ist, bedeutet diesem ein Indiz für die Verschlechterung des Weltzustands. Weiterhin ergibt sich bei Adorno ein Polarisierung der Sphären der Kunst: die Trennung der ästhetischen Bereiche großer Kunst als Ort der Autonomie und Kulturindustrie, als ein Bereich, in der die Marktgesetze jede Äußerung bestimmen. Bei Adorno erfährt Benjamins Gedanke zur Gegenwartskunst durch Adornos Applikation auf die Musik eine Zuspitzung, die mit ebensoviel Zuwachs an Differenzierung auf der einen, wie Verlust an Differenziertheit auf der anderen Seite einhergeht. Die völlige Mißachtung des ästhetischen Moments in der Unterhaltungsmusik ist mit Blick auf das systematische Motiv, den »autonomen« Kunstbereich im Gegenzug zu stärken, wohl verständlich zu machen. Trotzdem muß der Aufsatz unbefriedigend bleiben.
Die Analogie zwischen Gesellschaft und Musik, Ökonomie und Musik, Tiefenpsychologie und Musik, wird gesetzt ohne jeden Versuch einer Transformation oder auch nur einer methodologischen Erläuterung. Das entscheidende Problem, das sich jedem Ansatz zu einer soziologischen oder ökonomischen Erklärung der Kunst stellt - die Weisen der Einwanderung von Gesellschaftlichem in die Kunst zu rekonstruieren, ohne dabei zugleich den ästhetischen Charakter der Phänomene aus dem Blick zu verlieren, wird von Adorno hier noch gar nicht wahrgenommen. Mit anderen Worten: Das Problem der »Vermittlung«, das hier besteht, bleibt ungelöst - ja unbearbeitet.
In seiner »Ästhetischen Theorie« greift Adorno nun den Gedanken der Aura wieder auf und übt Kritik an Benjamins Methodik. Mit der dichotomischen Gegenüberstellung des auratischen und des technisch reproduzierten Kunstwerks vernachlässige er um ihrer Drastik willen die Dialektik beider Typen. Für ihn macht der Originalcharakter des Kunstwerks nicht dessen Aura aus, sie ist für ihn nicht auf einmalige Materialität begründet, sondern auf ästhetische Einmaligkeit und damit das Qualitätskriterium großer Werke. Des weiteren nimmt er Bezug auf die Kampfansage Benjamins an die faschistische Kunstpolitik. Der Widerstand gegen die gesellschaftliche Herrschaft hätte nach seiner Auffassung nicht in der Anpassung der Kunst an - seien es auch fortschrittliche - gesellschaftliche Zwecke, sondern vielmehr in der Wahrung der ästhetischen Autonomie als einer Position der Humanität zu bestehen. Er bestreitet auch gerade den Verfall einer Aura.
Was zunächst wie ein Verlust aussehen mag, erscheint aus der Distanz der Reflexion als integrales Moment einer dialektischen Widerspruchseinheit. Für Adorno ist die »Entkunstung der Kunst« nicht die Stufe ihrer Liquidation, sondern ein Faktor ihrer Dynamik. Den Verfall der Aura deutet er um als ihr Reflexionsmoment. Beklagt Benjamin den Verfall der Aura und damit den Verfall der Kunst, stellt der Verfall der Aura nicht deren Ende, sondern im Gegenteil das Wesen der auratischen Erscheinung dar. Denn für ihn hat das Verlöschen der Erscheinung selbst den Charakter einer Erscheinung des Verlöschens der Erscheinung, und diese macht in ihrer allemal zu beklagenden Vergänglichkeit den »Gehalt« der Kunst aus. Er gibt die große Kunst nicht verloren. Das, was er im Anschluß an Benjamin Aura nennt, wird ihm zum vorrangigen Merkmal der ästhetischen Autonomie. Aus dem Übergewicht der technischen Kultur, die von beiden in ihrer Ambivalenz erkannt wird, folgert Benjamin den Verlust der Subjektivität des Kunstwerks, Adorno dagegen spricht dem Kunstwerk stellvertretend für die menschlichen Verluste um so mehr, ja alle überhaupt noch mögliche Subjektivität zu. Adorno argumentiert gegen Benjamin weder transzendentalphilosophisch, noch anthropologisch, sondern »dialektisch«. Der Gedanke der Aufhebung, ein Moment, den er im Anschluß an Hegel zum Verständnis des Zusammenhangs von Kunst und Gesellschaft immer wieder geltend macht, ist maßgebend für ihn.
4. Bezüge zu Jean-François Lyotard
In seinem Aufsatz »So etwas wie ›Kommunikation ohne Kommunikation‹«(14) beschäftigt sich der französische Philosoph Jean-François Lyotard mit der Problem der sich ändernden Rezeption oder Kommunikation zwischen Kunstwerk und Rezipienten in der Moderne. Ausgehend von zwei sich diametral unterscheidenden Zitaten von Adorno und Immanuel Kant, die sich mit dem Begriff der Kommunikation beschäftigen, stellt Lyotard folgende Frage: »Die Frage, die ich dramatisieren möchte, lautet: wie steht es zu einer Stunde um eine Kommunikation ohne Begriff, wo die auf die Kunst angewandten ›Produkte‹ der Technologien eben gerade nicht ohne die massive und hegemonische Intervention des Begriffs hergestellt werden können?« (15) Die Kommunikation ohne Begriff leitet er aus dem Kommunikationsbegriff Adornos her, der - so Lyotard - die Vorstellung impliziert, daß »wenn es in der Kunst eine Kommunikation gibt, diese ohne Begriff sein muß. [...] Es gibt ein Denken der Kunst, das kein Denken der Nicht-Kommunikation, sondern der nichtbegrifflichen Kommunikation ist.« (16)
Der Ansatz Adornos, der entgegen des zuvor genannten Widerspruchs in der Tradition Kants steht, der wiederum die Mittelbarkeit von Kunst mit dem Gefühl des Schönen untrennbar verbindet, zielt genau auf die Rezeption des Kunstwerks. Laut Lyotard unterscheidet Kant das Gefühl des Schönen von anderen Affekten einschließlich des Gefühls des Erhabenen und fordert so, daß dieses Gefühl Transitivität sein muß. Es muß ein Gefühl sein, daß dem Kunstwerk immanent ist und vom Rezipienten erkannt werden kann, aber nicht muß um an ihm Gefallen zu finden. Diese Transitivität ist laut Lyotard im Geschmacksurteil zugleich »einforderbar und erforderlich« (17), damit es Kunst gibt. Nun ist zu fragen, wie sich diese Mitteilbarkeit auf das Kunstwerk und die Situation seiner Perzeption auswirkt. Diese Mitteilbarkeit sei »im singulären ästhetischen Gefühl enthalten, und dieses singuläre ästhetische Gefühl ist der unmittelbare, das heißt zweifellos der reinste Modus einer Empfänglichkeit für Raum und Zeit (als notwendige Formen der aisthesis). Kann diese Mitteilbarkeit fortbestehen, wenn die Formen, die ihr Anlaß sein sollen, entweder bei ihrer Erzeugung oder bei ihrer Übertragung begrifflich bestimmt werden? Wie steht es mit dem ästhetischen Gefühl, wenn kalkulierte Situationen ästhetisch gemeint sind?« (18)
Mit den Kategorien von Raum und Zeit sind nicht weniger die Benjamins, nämlich das Hier und Jetzt gemeint. Im Vergleich scheint jedoch Benjamin an der Oberfläche des Problems zu bleiben, wenn Lyotard seine Argumentation wissenschaftlich herleitet. Ein wichtiger Argumentations- punkt ist für ihn der Gegensatz zwischen Empfänglichkeit (passibilité) und Aktivität, den er jedoch kritisch hinterfragt. Wir sind empfänglich, weil uns etwas widerfährt, das wir nicht vorher kontrolliert, programmiert haben oder begrifflich erfahren.
»Das Gefühl ist der unmittelbare Empfang dessen, was gegeben ist. Die Werke der neuen techne sind entweder bei ihrer Produktion und/oder ihrer Reproduktion oder bloß bei ihrer Verbreitung durch ein (oder mehrere) Kalkül(e) bestimmt worden. Das hinterläßt notwendigerweise Spuren…« (19) Lyotard meint mit diesen Kalkülen die Zeit, auch die Zeit, die zur Herstellung, Produktion und Verbreitung etc. des Kunstwerkes verwendet wird. Ein ästhetisches Gefühl scheint ihm unmöglich zu sein, wenn es allein aus der kalkulierten Repräsentation hervorgeht, deren die industrielle Reproduktion huldigt wie keine zweite Entwicklung. Wenn man folgende Kategorien als analog zu Benjamins Hier und Jetzt versteht, läßt sich folgender Satz kongruent zu Benjamins Thesen verstehen: »…das, was in der Moderne oder Postmoderne vielleicht zuerst betroffen ist und sich beklagen läßt, sind Raum und Zeit.« (20)
In Hinblick auf die Diskussion um die Postmoderne läßt sich sagen, daß sie eine Weiterführung der Moderne auch im Hinblick auf die Rezeption des Kunstwerkes darstellt. Zu Beginn des 19. Jh., bestimmt der Satz Hölderlins: »In der äußersten Grenze des Leidens besteht nämlich nichts mehr, als die Bedingungen der Zeit oder des Raumes« die Diskussion. Bei Hegel, der das »Ende der Kunst« (21) zu entdecken glaubte, werden diese Kategorien bereits aufgelöst, da er zeigt, daß Raum und Zeit ihre Wahrheit nicht in sich, sondern im Begriff haben, »daß es kein Hier und Jetzt gibt, daß es nur Wahrnehmung gibt, daß das Sinnliche immer schon durch den Verstand vermittelt ist.« (22) Lyotard geht in seiner Deutung weiter: »Geht in dieser Krise, die die Bedingungen von Raum und Zeit betrifft (und zwar in zwei Ausprägungen, nämlich der modernen: es bleiben nur noch Raum und Zeit, und der postmodernen: es bleiben uns nicht einmal mehr Raum und Zeit)…« (23) Benjamin griff so also mit seinen Ausführungen den Gedanken und Problemen der Postmoderne vor. Das Zauberwort der Interaktivität von Kunst, die in der technisierten Zeit immer mehr gefordert wird, greift in Bezug auf die Rezeption von Musik nicht. Laut Lyotard soll der, »der empfängt nicht empfangen, sich nicht aus der Fassung bringen lassen. Er soll sich selbst als aktives Subjekt in bezug auf das konstituieren, was ihm zuteil wird: sich unmittelbar rekonstruieren und sich als jemand, der interveniert, identifizieren.« (24) Bei der Empfänglichkeit in Verbindung mit musikalischen Kunstwerken ist aber einen Interaktivität nur schwer möglich; hier war sie in der Konzertsituation schon eher möglich, denn als Hörer eines technisch vervielfältigten Kunstwerks. Mit der Empfänglichkeit ist vielmehr eine gefühlsmäßige Gemeinschaft umrissen, die ihr Gemeinschaftsgefühl aus dem singulären ästhetischen Gefühl herleitet. In einem Konzertsaal z.B. entsteht aus dem Empfinden jedes einzelnen Besuchers ein Gemeinschaftsgefühl, welches durch die Kategorien Raum und Zeit vermittelt wird, dessen sich die Besucher aber auch gar nicht bewußt sein müssen. Diese gefühlsmäßige Einstimmigkeit ist laut Lyotard nicht abhängig von der Gestalt des Dargestellten oder der Form der Darstellung, sondern konstituiert sich allein aus der Modalität der Rezeption.
In seinem Aufsatz »Der Gehorsam« (25) beschreibt Lyotard die möglichen Implikationen, die die Möglichkeit der technischen Reproduktion eines Kunstwerks - hier die Musik - auf das musikalische Material selbst haben kann. Er spricht dabei von Rechten und Wünschen, die die neuen Technologien in der Welt der Klänge anmelden können, die nicht unbedingt den menschlichen Partner betreffen können sondern auch Materialimmanent sein können, »…die auch Rechte und Wünsche des Materials oder des Klanges sein können«. (26) Laut Adorno ist das Werk ein Rätsel und muß es auch bleiben, was es erklärt und in eine faßbare Form bringt ist die Technik. Die »Entfesselung« des Materials, die gleichzeitig auch eine Befreiung von Bevormundung ist, eröffnet so laut Lyotard die Perspektive der Beherrschung des Klanges durch die Technik. Diese These böte dann eine Möglichkeit, in der sich Musik und Technologie begegnen könnten. Das Eindringen in das Material, das mit der Elektronischen Musik wohl am besten dargestellt werden kann, ist ein integraler Bestandteil der musikalischen Komposition der Postmoderne. Sie ist Musik ohne den verbrämenden Mantel der Tradition, sie hat sich von ihr befreit, weil sie keine Tradition hat. Hier wird die Musik auf das zurückgeführt, was sie im Innersten ist, »nämlich die Schwingung der Luft mit ihren ihrerseits wieder analysierbaren Bestandteilen: Frequenz, Amplitude, Dauer und einige feinere, nämlich die Farbe, der Auftakt.« (27)
Das Hintersichlassen von Tonhöhen, Tonarten und Tonleitern, das die »Entfesselung des Klanges« mit sich bringt ist indes kein neues Bestreben. Schon Mozart versuchte unter Einbeziehung der türkischen Musik neue Klangfarben und Tonarten zu erschließen. Genauso wie später Debussy mit Hilfe der birmesischen Gamelan Musik, die einen besonderen Schwerpunkt auf die perkussiven Klänge legt. Lyotard diskutiert zur Veranschaulichung das Problem der Chromatik, die sich nicht durch eine Form anordnen muß, sondern sich selbst durch seine Materie anordnet.
»Die chromatischen Werte ordnen sich an, ohne durch einen Begriff organisiert zu werden, auch nicht durch einen Begriff der sie leitet. Die Schönheit, wenn ich es wagen darf, diesen Ausdruck zu benutzen, wird durch diese Selbstzweckmäßigkeit ohne Zweck erlangt.« (28) Die »Entfesselung des Klanges«, die z.B. Varèse nur auf die klangliche Ebene bezieht, läßt sich also in diesem Zusammenhang der Paradigmenwechel in der Musik auf das gesamte Material anwenden, auch, wie hier auf die Tonleitern. Die Hinwendung zur »freien Form« (ein Widerspruch in sich selbst, da es keine Form mehr ist, aber aus Mangel an anderen Begriffen und durch Gebräuchlichkeit dieses Terminus, sei er hier erlaubt) ist somit nicht nur, wie Lyotard bemerkt, die »Befreiung von den großen, durch die Tradition akkreditierten, musikalischen Formen, in der Hauptsache von der Sonatenform« (29), sondern betrifft auch die Behandlung des musikalischen Materials als solches, nämlich als Material, das sich selbst in sich »formt«, ohne auf es betreffende Traditionen Rücksicht zu nehmen. Die Musik als Tonkunst versucht sich so von der Musik als Musik zu lösen und tritt so wieder in den Kanon der Wissenschaften ein, unter die septem artes liberales, zu der sie im Mittelalter in Anlehnung an die Griechen gezählt wurde. Zusammen mit der Mathematik, der Geometrie und der Astronomie gehörte sie zum quadrivium. Ob diese Hinwendung zum Wesentlichen durch die Verwendung möglichst weniger nur minimaler Mittel, oder möglichst vieler komplexer Strukturen geschieht, macht im Prinzip keinen Unterschied. Es lassen sich zwei Grundströmungen herausfiltern. Die eine, die die Klänge einfach sein läßt, wie bei Cage, oder die andere, die durch das Übermaß an komplexen Strukturen die Hörgewohnheiten zerstört und zu einem neuen Hören von Musik führt. Lyotard sieht darin die Möglichkeit, »zu einem Naturzustand des Hörens, dessen Verlust die musikalische Kultur bewirkt hat, zurückzukehren.« (30)
Lyotard geht es in der Tonkunst nicht um die Entfesselung des Klanges, sondern um die des Gehorsams. Der Form als sinngebender Einheit von Musik ist bedingt durch die musikalische Tradition zu viel Bedeutung zugemessen worden und das Material ist dabei in den Hintergrund geraten. Diesen Umstand zu ändern ist die Möglichkeit der neuen Technologien, deren Auswirkungen auf die zeitgenössische Kunst zu bemerken ist, mehr noch als auf die reproduzierte Musik vergangener Epochen.
5. Schlußbemerkungen
Ausgehend von Walter Benjamins Text »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« aus dem Jahre 1935 und die daran anschließende Diskussion mit Adorno zeigt sich, daß der als negativer Impetus betrachtete Wandel der technischen Möglichkeiten sich ausgehend von der reinen Reproduktion vorhandener Kunstwerke in die Kunstwerke selbst eingeschrieben hat.
Betrachtet Benjamin die Entwicklung der Reproduktionsmedien und die Auswirkungen, die sie auf das Kunstwerk haben eher pessimistisch und beklagt diese, so sieht Adorno in ihnen eher eine Chance. Adorno sah in der Entfesselung des Materials über die Form - die die neuen technischen Möglichkeiten implizieren - eher eine steigende Möglichkeit, es technisch zu beherrschen. Benjamins Ansatz in der Gegenüberstellung von auratischem und reproduziertem Kunstwerk ist insofern eindimensional, da er die Dialektik beider Begriffe aus Gründen der Vereinfachung vernachlässigt. Adorno hingegen betrachtet die beiden Begriffe auf dialektischer Grundlage und umgeht so die Missinterpretationen, denen Benjamin erliegt.
Von außerordentlicher Wichtigkeit im Umgang mit Kunst in der Moderne hat sich die veränderte Rezeption derselben herauskristallisiert. Das Verlorengehen der Kategorien des Hier und Jetzt des Kunstwerkes, welche die herausragenden Bestandteile der Aura bei Benjamin sind, werden bei Lyotard kritisch hinterfragt, als Kategorien, die schon seit Hegel eine Ambiguität erhalten. Sie waren nie feste Größen, sondern immer schon durch die Wahrnehmung terminiert.
Ausgehend von den Thesen Benjamins ist aber auch noch klar geworden, daß in der sogenannten Postmoderne die veränderten Produktions- und Rezeptionsbedingungen ihre Auswirkungen auch auf das musikalische Material selbst haben. Dabei sind Veränderungen der Formen, wie etwa das Aufkommen der »Radiokomposition« als einem Kompositionsauftrag, die durch senderbedingte Budget- oder Personalfragen beeinflußt werden nur oberflächlich und ein offensichtliches Beispiel. Viel mehr in die Tiefe gehen Veränderungen das Material betreffend, die an der Elektronischen Musik exemplarisch dargestellt werden können. Die Entfesselung der Klänge, die sich eben nicht nur auf die Klänge, sondern auch auf die Entfesselung der Form und aller anderen Bestandteile bezieht, ist hier wohl am komplettesten vollzogen und wird immer noch weiter geführt.
Die Emanzipation des Materials von der Form - und somit von der musikalischen Tradition - ist folgerichtig die einschneidende Entwicklung in der Musik wie in der Kunst überhaupt und erschließt vielleicht, ausgehend von den Thesen Benjamins bis zu Lyotards ein neues Vokabular zur Diskussion Neuer Musik oder Musik überhaupt.
6. Bibliographie
Adorno, Theodor W.: Zeitschrift für Sozialforschung, hg. von Max Horkheimer, Jahrgang 7 (1938), Nachdruck München 1980, 321-356.
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt/Main (Suhrkamp), 1968 (2. Auflage).
Lyotard, Jean-François: so etwas wie Kommunikation ohne Kommunikation, in: Engelmann, Peter (Hrsg.): Jean-François Lyotard - Das Inhumane, Plaudereien über die Zeit, Wien (Edition Passagen), 1989
Lyotard, Jean-François: Der Gehorsam, in: Engelmann, Peter (Hrsg.): Jean-François Lyotard - Das Inhumane, Plaudereien über die Zeit, Wien (Edition Passagen), 1989
Fußnoten
1. Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt 1968, 2. Auflage. (Alle weiteren Zitate aus diesem Werk beziehen sich auf diese Ausgabe.)
2. Benjamin, S.9
3. Benjamin, S.9
4. ebda., S.11
5. ebda., S.13
6. ebda., S.13
7. ebda., S.13
8. ebda., S.13
9. ebda., S.15
10. ebda., S.17
11. ebda., S.17
12. ebda., S.21
13. Adorno, Theodor W.: Zeitschrift für Sozialforschung, hg. von Max Horkheimer, Jahrgang 7 (1938), Nachdruck München 1980, 321-356.
14. Vortrag beim ersten Kolloquium Art et communication, das im Oktober 1985 auf Initiative von Robert Allezaud an der Sorbonne abgehalten wurde. Unter seiner Herausgeberschaft erschienen in dem Sammelband Art et Communication, Paris 1986.
15. Ich beziehe mich in dieser Arbeit auf die deutsche Übersetzung: Lyotard, Jean-François, So etwas wie Kommunikation ohne Kommunikation, in: Das Inhumane. Plaudereien über die Zeit. Hrsg. Engelmann, Peter, Edition Passagen, Wien, 1989.
16. Lyotard, Kommunikation ohne Kommunikation, S. 190
17. ebda.: S. 190
18. ebda.: S. 192
19. ebda.: S. 192-193
20. ebda.: S. 194
21. ebda.: S. 195
22. ebda.: S. 199
23. ebda.: S. 199
24. ebda.: S. 202
25. ebda.: S. 203
26. Beitrag zum Kolloquium De l’ecriture musicale, das auf Initiative von Christine Buci-Glucksmann und Michaël Levinas im Juni 1986 vom Collège international de philosophie und dem Itinéraire an der Sorbonne organisiert wurde. Erschienen in: InHarmoniques 1, 1987. Ich beziehe mich in dieser Arbeit auf die deutsche Übersetzung: Lyotard, Jean-François, Der Gehorsam, in: Das Inhumane. Plaudereien über die Zeit. Hrsg. Engelmann, Peter. Edition Passagen, Wien 1989.
27. ebda.: S. 285
28. Lyotard, Der Gehorsam, S. 279
29. ebda.: S. 285
30. ebda.: S. 290
31. ebda.: S. 291
32. ebda.: S. 298
© 2000 by Andreas Höflich
|
|